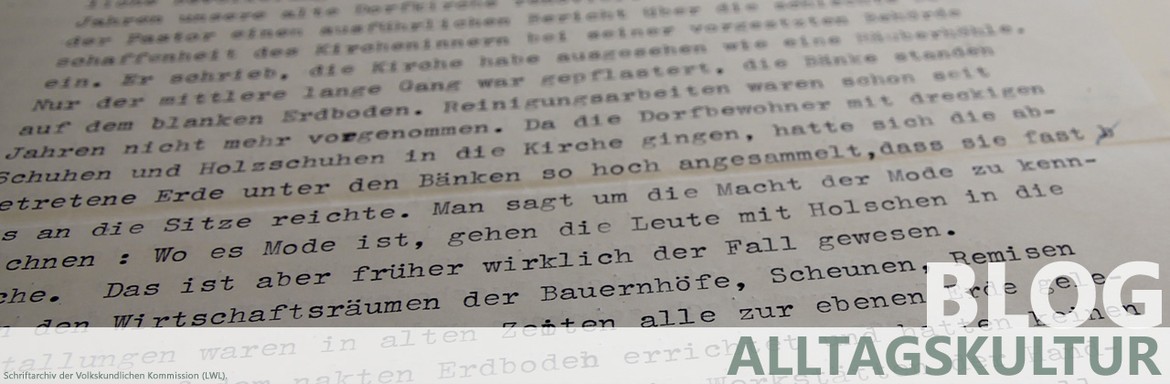Jagdbezirke, in denen die Bauern nicht selber jagen gingen, wurden an Berufsjäger verpachtet und die Pacht als sogenanntes Jagdgeld an die einzelnen Landwirte ausgezahlt:
„Eigenjagdbezirke hat es in Lavesum nie gegeben, da keiner der wenigen Bauern, die 300 Morgen und mehr besitzen, ihre Ländereien arrondiert liegen haben, wie das Jagdgesetz es diesbezüglich vorschreibt. Auch von der vor 1933 bestehenden Möglichkeit, daß sich 2 Bauern durch Zusammenfassung ihrer Grundbesitzungen einen Eigenjagdbezirk schafften, wurde niemals Gebrauch gemacht. Das Pachtgeld für die Jagden wurden den Bauern früher auf ihre Morgenzahl umgerechnet als sog. Jagdgeld in bar ausgezahlt. In den 20er Jahren opferten es die Lavesumer Bauern für den Neubau ihrer Kirche.“ (M04029)
Einige empfanden diese Regelung in Anbetracht der teilweise erheblichen Wildschäden auf ihren Grundstücken allerdings als ungerecht, weshalb sie sich das Jagdgeld zwar auszahlen ließen, sich gleichzeitig aber als Wilderer betätigten:
„In Lavesum gab es früher stets 3–4 Wilddiebe, und sie waren offenes Geheimnis. Rein begrifflich rechne ich sie bezüglich ihrer Leidenschaftlichkeit, mit der sie ihre verbotene Tätigkeit ausübten, zu den echten Jägern, die man keineswegs mit den heutigen Aasjägern, die vom Auto aus gewerbsmäßig ihr Handwerk betreiben, vergleichen darf. Im gewissen Sinne fühlten sie sich sogar zu ihrem Tun gerechtfertigt, weil sie das Jagdgeld nicht als vollen Ausgleich für die ihnen vom Wild verursachten Flurschäden ansahen.“ (M04029)
Während einige Wilddiebe heimlich mit dem Gewehr auf die Jagd gingen und beispielsweise des Nachts auf ihren Feldern Hasen schossen, übten sich die meisten im als unweidmännisch empfundenen Fallenstellen und bestätigten damit die Vorurteile der bürgerlichen Jäger. Aus der Nähe von Rheine wurde berichtet:
„Der Wildbestand in Uthuisen wurde arg mitgenommen durch Wilddiebe. Sie arbeiteten selten mit Gewehren, viel häufiger mit Schlingen. Sie strööpten. Sie hießen daher ganz allgemein auch Strööper. Strööpen = eine Schlinge zuziehen.“ (M05484)
Insbesondere unter Kleinbauern und Heuerlingen war das illegale Fallenstellen weit verbreitet. So heißt es in einem plattdeutschen Bericht über das Leben eines Kötters im Südlohner Feld um 1900: „Alls göng doch en Ströpen (Wildern). Ströpen dat dähn se alle. […] Un äöwwerall han se de Stricke (Schlingen) staohn.“ (M04701) Das Unrechtsbewusstsein hielt sich dabei in Grenzen, wie ein Bericht aus Stadtlohn belegt: „Das ist lautloses Jagen! Nicht erlaubt, aber genauso reizvoll wie das Schmuggeln im Grenzgebiet!“ (M06406)
War ein Bauer nicht Teil einer Jagdgenossenschaft, wollte aber dennoch gesetzeskonform auf die Jagd gehen, musste er über die nötigen Beziehungen oder finanziellen Mittel zur Nutzung eines Jagdbezirks verfügen. Die bürokratischen Anforderungen waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch vergleichsweise unkompliziert:
„Man ließ sich von Freunden, Verwandten oder Bekannten zur Jagd einladen, wenn diese eine Jagd hatten. Bei gutem Geldbeutel pachtete man sich selbst eine Jagd. Ein Jagdschein […] wurde einem ohne weiteres ausgestellt von der Verwaltung. Diese stellte dann nicht erst große Nachfragen an. Man hatte auch keine Prüfung zu machen. So ein Jagdschein kostete für 1 Jahr 0,- Mark. Alles ging also sehr einfach und schnell.“ (M05484)