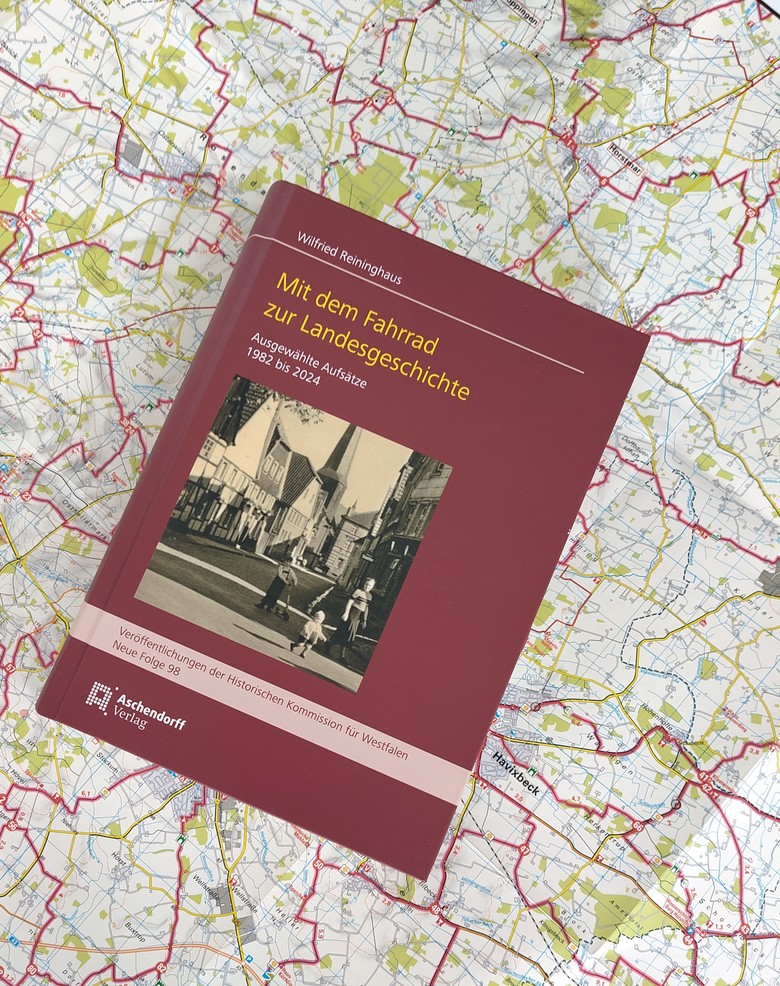Wilfried Reininghaus zeichnet auf überzeugende Weise das Bild einer komplexen und vielschichtigen, oft auch kleinteiligen Gewerbelandschaft mit langer Tradition. Leserinnen und Leser lernen beispielsweise Schwerte als bereits im 15. und 16. Jahrhundert „reiche Stadt“ kennen, deren Reichtum aus „mehr als einer Wurzel“ hervorging. „Der Austausch mit dem agrarischen Umland durch Märkte und Mühlen kam u. a. dem Schwerter Bier zugute, das sich im regionalen Absatz behauptete. Von der Schafzucht auf dem Haarstrang profitierten die Wolltuchmacher, die vor dem Ostentor eine Walkmühle betrieben. Das wichtigste Exportgut waren jedoch Metallwaren, vor allem die sogenannten ‚Panzer‘. So hießen Kettenhemden, die aus Draht mittlerer Stärke geflochten waren.“ (S. 20) Schwerter Kaufleute machten die Kettenhemden im gesamten Hanseraum bekannt, und so entstand im Zusammenspiel von Handwerk und Handel eine wohlhabende Oberschicht.
Dem Zusammenspiel von Handwerk, Handel und Sozialstruktur gehen verschiedene Beiträge nach. In den Blick gerät die Präsenz westfälischer Kaufleute auf Messen, beispielsweise in der Messestadt Leipzig, die deren Horizont sowohl ökonomisch als auch kulturell erweiterte. Westfälische Kaufleute erschlossen sich „Zugang zu ost- und südosteuropäischen Einkäufern“, und sie machten „früher als andere die Bekanntschaft mit Innovationen“, die sie in ihrer Heimatregion verbreiteten. „Kaufleute wirkten also als Vermittler auf ökonomischem und kulturellem Gebiet.“ (S. 123) Dass sich hier – oft in der Verbindung von Handel und Fertigwarenproduktion – eine „ländliche Version“ des Bürgertums herausbilden konnte, zeigt Wilfried Reininghaus am einschlägigen, aber eben nicht einzigen Beispiel der Familie Harkort. Ländliche Unternehmer und städtische Kaufleute in Westfalen „waren wirtschaftlich einander gleichwertig. Das schlug sich in den sozialen Beziehungen, in Heirats-, Verkehrs-, Kultur- und Kommunikationskreisen nieder.“ (S. 110)
Der überregionalen Einbindung durch den Fernhandel stand innerwestfälisch die Erschließung ländlicher Regionen durch den Wanderhandel – „Tödden“ und „Winterberger“ – zur Seite. Wilfried Reininghaus betont dessen Rolle als „Wegbereiter einer konsum- und marktorientierten Gesellschaft“ (S. 126). Deutlich wird ein eigentümliches Spannungsfeld zwischen ökonomischem und sozialem Status. Einerseits blühte der Wanderhandel in Regionen, in denen es einer wachsenden Zahl Menschen an Einkommensquellen in der Landwirtschaft fehlte. So existierten beispielsweise im Gebiet zwischen Rheine, Lingen und Osnabrück in den 1780er Jahren 1300 Wanderhändler. Andererseits konnten es Wanderhändler zu relativem Wohlstand bringen. Mit ihrem demonstrativen, beispielsweise von Justus Möser als verschwenderisch kritisiertem Konsum brachten sie Hierarchien und Statusunterschiede in ihren Heimatorten ins Wanken. Zudem gründeten viele Wanderhändler „Einzelhandelsgeschäfte in den Zielorten, nicht wenige wurden Ausgangspunkt von Filialketten im 20. Jahrhundert.“ (S. 132)
Einige der im Band versammelten Beträge beschäftigen sich mit historischen Reflektionen über „Westfalen“, sei es auf der Suche nach Besonderheiten und Charakteristika oder als Suche nach Perspektiven, etwa hinsichtlich des Gewerbes. Am Beispiel der wirtschaftspolitischen Diskussionen um die Garnbleiche von Stephanopel (Hemer) zeigt Wilfried Reininghaus, wie sich (ökonomische) Zukunftsentwürfe und regionale Konkurrenz überlagern konnten. Zahlreiche Planungen der 1760er Jahre folgten unverhohlen dem Ziel, die Leinwandbleicherei Elberfelds zu schwächen. „Bleichereien in der Grafschaft Mark sollten künftig verhindern, dass rohes Garn aus den preußischen Gebieten Minden-Ravensberg und Halberstadt im Wuppertal veredelt wurde. Die bergische Wirtschaft konnte damit empfindlich getroffen werden. […] Das lohnende Ziel, dem sämtliche wirtschaftspolitischen Maßnahmen im Textilgewerbe zugrunde lagen, war die Schädigung, wenn nicht Ausschaltung der bergischen Konkurrenz in der unmittelbaren Nachbarschaft.“ (S. 49)
Die skizzierten Diskussionen weisen bereits auf ein zentrales Problem jeder westfälischen Landesgeschichte hin: die Frage der Bezugspunkte für die Herausbildung kollektiver Identitäten. Wilfried Reininghaus geht dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven überzeugend an. Er rekonstruiert unterschiedliche Entwürfe einer westfälischen Landesgeschichte, etwa die Arbeiten des Elseyer Pfarrers Johann Friedrich Möller um 1800. In Möllers Überlegungen finden sich eine skeptische Einschätzung des sich anbahnenden industriellen Fortschritts und die Diagnose einer – vermeintlichen – „Lockerung“ der Sitten, erkennbar daran, dass „zum Beispiel die Tanzsucht und das Schützenwesen überhandnehmen und Lesegesellschaften zu Vergnügungsvereinen verkommen.“ (S. 236)
Wilfried Reininghaus befasst sich systematisch mit derartigen Überlegungen. Er benutzt sie, um eine reflektierte Konzeption westfälischer Landesgeschichte zu entwickeln. Er beharrt mit guten Gründen darauf, dass sich von Westfalen nur im Plural sprechen lässt. Bis weit ins 19. Jahrhundert meinte „Westfalen“ mindestens dreierlei: erstens „einen Raum im geographischen Sinn, der sich vom Kamm des Rothaargebirges weit nach Norden bis kurz vor die Nordsee erstreckte“; zweitens die zahlreichen Herrschaftsgebiete innerhalb dieses Raums mit ihrer je eigenen Verfassung; drittens die seit 1815 bestehende preußische Provinz Westfalen, die mit Wittgenstein und dem Siegerland einerseits Teile enthielt, „die nicht zum geographischen Raum Westfalen gehörten“, während sie andererseits „unstrittige Teile des ‚alten Westfalen‘, nämlich das Niederstift Münster, Osnabrück, Waldeck und die kölnische Exklave Volkmarsen“, nicht umfasste. (S. 295) Der seit dem Mittelalter überkommene Westfalenbegriff – Westfalen als Ensemble zahlreicher weltlicher und geistlicher Territorien, das „dennoch ein System bildete, das sich ‚trotz der Vielzahl der Territorien als Rechtsgemeinschaft‘ verstand“ (S. 296) – geriet mit dem Ende des Alten Reichs um 1800 allerdings unter Druck, weil die einzelnen Territorien immer deutlicher eine eigenständige Identität und Eigenstaatlichkeit entwickelten. Mit der Schaffung der Provinz Westfalen entstand zwar ein in rechtlicher und administrativer Hinsicht einheitlicher Raum, allerdings bestanden konfessionelle und andere Spaltungen fort. Die Landesgeschichte blieb zudem an den Territorien des Alten Reichs orientiert. „Es waren also immer nur einzelne Teilgebiete Westfalens, die die Aufmerksamkeit der damals tätigen Historiker fanden. Das Gesamtgebiet der Provinz blieb unbehandelt. Westfalen war 1911 die einzige preußische Provinz, für die es trotz eines Ministerialerlasses vom 31. Januar 1908 noch keine ‚zusammenhängende Darstellung der Geschichte‘ gab.“ (S. 305) Das änderte sich erst in den 1920er Jahren mit der an Bedeutung gewinnenden (westfälischen) Heimatbewegung, der Gründung des Instituts für westfälische Landes- und Volkskunde (1929) und dem Projekt, den „Raum Westfalen“ mit seinen Grenzen, Gemeinsamkeiten und Besonderheiten historisch zu vermessen.
Bleibt nur noch die Frage zu klären, was es eigentlich mit der „Landesgeschichte auf und mit dem Fahrrad“ auf sich hat. Wilfried Reininghaus schreibt im Epilog von einem geplanten Buchprojekt mit diesem Titel. „Es sollte anhand von ausgesuchten Routen quer durch Westfalen zu historisch interessanten Plätzen führen. Eine Umrundung der Grenzen des Teilbundeslandes und die anschließende Berichterstattung darüber, verbunden mit Forschungen zu Grenzbeziehungen in Westfalen, stand auf der Agenda, ehe Corona und sonstige Widrigkeiten einen Strich durch die Rechnung machten.“ (S. 379) Er berichtet von systematischen und projektbezogenen Radtouren seit den späten 1980er Jahren, „jeweils vorbereitet durch Studium von Karten im Maßstab 1:50000 oder kleiner. […] Mich trieb es immer wieder auf dem Rad zu Orten, die meine historische Neugier geweckt hatten“ (S. 380) Wilfried Reininghaus versteht „Inaugenscheinnahme“ als „unverzichtbares Instrument landesgeschichtlicher Forschung“. Das und methodische Reflexion machen die Landesgeschichte zu einer „Beobachtungswissenschaft“. (S. 382)
Die große Stärke des Bands liegt darin, dass er die Komplexität und Vielschichtigkeit einer Region sichtbar macht. Zwei Punkte sind dabei bemerkenswert: einerseits eine kleinteilige und diversifizierte Gewerbestruktur, die sich im Prozess der Industrialisierung nicht nur als außerordentlich resilient erweisen sollte, sondern diesen Prozess durchaus begünstigte; andererseits das früh einsetzende und von der heutigen Landesgeschichte kritisch reflektierte Nachdenken über „Westfalen“ angesichts zahlreicher innerer und äußerer Grenzziehungen und Spaltungen. Dabei zeigt sich, dass eine Region stets ein fragiles Gebilde ist. Einigen der Beiträge merkt man ihr Alter an, verweisen sie doch auf Forschungskontexte, die heute nicht mehr in jedem Fall prominent sind (zum Teil freilich deshalb, weil die damit verbunden Fragen intensiv erforscht und in den Grundzügen geklärt wurden). Das ändert aber nichts daran, dass es sich um einen lesenswerten Band handelt.
Literatur:
Reininghaus, Wilfried: Mit dem Fahrrad zur Landesgeschichte. Ausgewählte Aufsätze 1982 bis 2024. Aschendorff: Münster 2025.