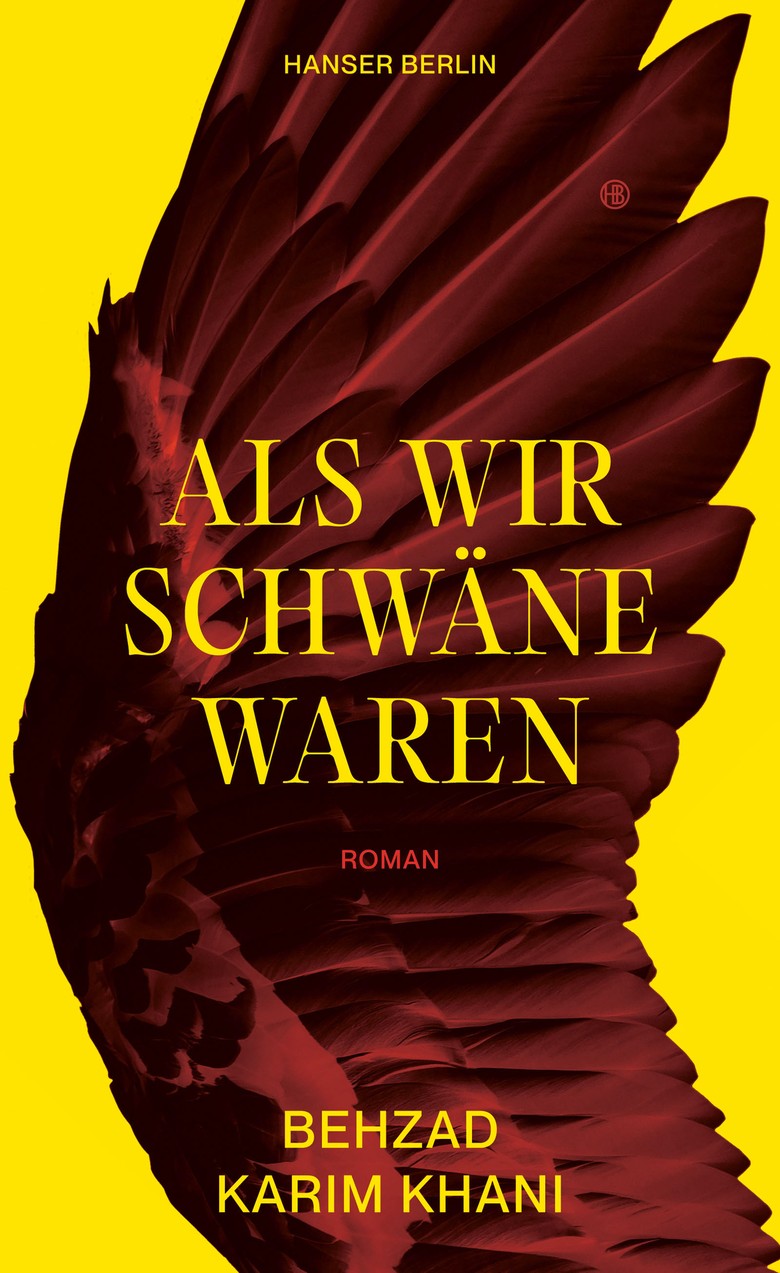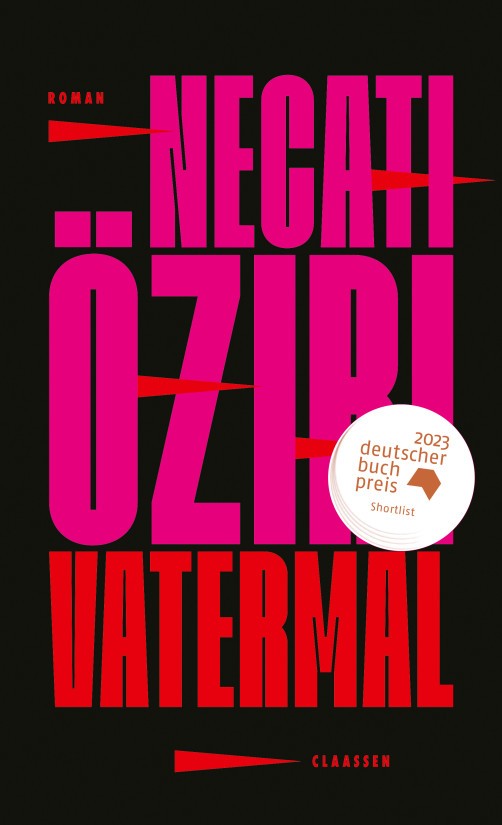Öziris Roman spielt in einer türkischen Kleinfamilie. Es wird gestritten, laut lamentiert, geweint, geflucht, aber auch viel gelacht – alles wie im wirklichen Leben also. Was die Protagonisten vereint, ist ihre Hoffnung auf ein "kleines privates Glück" in einer Welt, in der einem nichts geschenkt wird. Wohl dem, der bei all dem Durcheinander einen klaren Lebensplan hat. Ardas labiler Vater, Metin, hat ihn durchaus nicht. Er hat, noch in der Türkei lebend, einen Mord verübt. Im Auftrag seines Familienclans hat er seinen Bruder gerächt, der einem politisch motivierten Mord zum Opfer gefallen ist. Anschließend ist er auf Drängen seiner Eltern mit seiner jungen Frau Ümran nach Deutschland geflüchtet, hat Asyl beantragt und Arbeit in einer Schlachterei gefunden. Doch was soll er hier, in einer Umgebung, die ihm nur Verachtung entgegenbringt? Das Heimweh nagt an ihm. Daran können auch seine beiden kleinen Kinder nichts ändern. Metin fasst den Entschluss, in die Türkei zurückzukehren. Er verlässt seine Familie klammheimlich und ohne Abschiedsgruß. In seinem Heimatland angekommen, wird er erwartungsgemäß noch auf dem Flugplatz festgenommen und inhaftiert. Nach seiner Freilassung beginnt er in Istanbul ein neues Leben mit einer anderen Frau, wird erneut Vater – ohne jemals den Kontakt zu seiner früheren Frau und seinen Kindern wieder aufzunehmen.
Ümran, seine erste Frau, wirft das alles aus der Bahn. Nach Metins Flucht ist die nun alleinerziehende Mutter hoffnungslos überfordert. Sie greift zum Alkohol, hat wechselnde Männerbekanntschaften, vernachlässigt ihre Kinder. Erneut muss sie sich Vorwürfe anhören. Wie solle aus ihren Kindern etwas Ordentliches werden, wenn sie nur Tütensuppen und Ravioli aus der Dose zu essen bekommen? Ümran will ‚funktionieren‘, sogar "deutscher als jede Deutsche" sein, bringt hierzu jedoch die Kraft nicht auf. Im Verlauf des Romans wird Ümrans Lebensgeschichte differenziert ausgeleuchtet. Es ist viel von geplatzten Hoffnungen und Träumen die Rede. Sie enden in demütigenden Tätigkeiten bei McDonalds und in einem Döner-Imbiss. Abwechslung bieten Ümran lediglich feuchtfröhliche "Damenabende", zu denen sie sich herausputzt wie eine Filmdiva.
Dass unterdessen ihre Familie auseinanderbricht, nimmt sie lethargisch hin. Wie so oft sind es die Kinder, die mit dem Leben besser klarkommen als ihre Eltern und einen konziseren Plan besitzen. So verlässt Aylin, Schwester des Erzählers, der ständigen Streitereien mit ihrer Mutter überdrüssig, die übelriechende Wohnung in einer Mietskaserne, kommt bei einer Pflegefamilie unter, macht später eine Banklehre und verliebt sich in eine Polizistin, mit der sie zusammenlebt. Ihren Namen hat sie unterdessen in "Yvonne" geändert.
Behzad Karim Khanis Roman Als wir Schwäne waren führt in ein Bochumer Problemviertel. Dorthin hat es Reza im Alter von zehn Jahren verschlagen. Seine Mutter ist Soziologin, sein Vater Schriftsteller. Das akademische Elternhaus tritt aber bald in den Hintergrund. Als Teenager wird Reza mit der ganzen Härte des Bochumer Ghettos konfrontiert. Dort herrscht das Gesetz der Straße und eine Hoffnungslosigkeit und Kälte, die jede Menschlichkeit erstickt. Er entwickelt Wut und Hass auf eine Umgebung, in der er an jeder Häuserecke mit Gewalt, Kriminalität und Demütigungen konfrontiert wird. Was Reza von seinem Umfeld unterscheidet, ist seine Fähigkeit zur Reflexion – und ein Rest an Humanität, den ihm sein Elternhaus eingeimpft hat. Er nutzt sie, um sich Jahre später diese, seine Geschichte von der Seele zu schreiben. In einer teilweise hochsensiblen Sprache, die aber im nächsten Moment in schockierende Direktheit umkippen kann. Nämlich dann, wenn realistisch beschrieben wird, wie es in einer Ruhrgebiets-Bronx zugeht. Dort, wo es wirklich wehtut und man lernen muss, sich zu wehren.
Und das macht Reza auch. Er ist von der Gelehrsamkeit seines Vaters zwar beeindruckt, hält dessen Bildungsfundus aber für ‚totes Wissen‘. Reza bezieht seine Lebenserfahrung nicht aus Büchern, sondern aus der Realität. Sein Lebensmittelpunkt ist die Profanität der erwähnten prekären Plattenbausiedlung. Dort ist Rap-Musik härtester Gangart angesagt. Mit etwa zwölf Jahren wird er Mitglied seiner ersten Jugendgang. Er sagt über sich und seine Freunde: "Wir sind ein Alptraum. Ich weiß nur nicht, wessen." Das Ghettoflair steckt ihm in den Kleidern: "Unsere Küchen haben keine Abzüge. In unseren Fluren riecht es. Nach Armut, Majoran und Bockshornklee. Nach Reis und Schmortöpfen. Nach gebratenen Zwiebeln mit Kurkuma. Nach Kinderzimmern mit Etagenbetten und Arbeitslosigkeit. Nach Zimt, Sozialhilfe und Großfamilien."
Die nächste Eskalationsstufe wird mit den Worten eingeleitet: "Ich werde zu Hause etwas stiller und draußen etwas lauter." Bei Heimspielen des VfL Bochum mischt sich Reza unter die Ultras. Allerdings nicht des eigenen Clubs, sondern der gegnerischen Mannschaften, die er anfeuert. Die Stadion-Hymne, Herbert Grönemeyers Bochum, brandmarkt er als verlogen. Für Reza und seine Kumpels stellt sich die Welt anders dar: "Unser Ruhrgebiet ist dürr, verbittert. Kauft unentwegt Müll und kann ohne Fernseher nicht einschlafen. Ohne Schminke sein Antlitz nicht ertragen. Da sind keine Blumen im Revier."
Reza beginnt zu dealen. Zunächst im kleinen Maßstab. Doch das ändert sich. Es geht bald nicht mehr um Gramm, sondern um Kilo Rauschgift. Bis er von der Polizei erwischt wird und ein Einsatzkommando der Polizei die elterliche Wohnung stürmt. Er wird auf Bewährung verurteilt. Reza verlässt Bochum und geht nach Berlin-Kreuzberg, arbeitet auf Baustellen und in Küchen, verdient "schnelles Geld". "Ich brenne für gar nichts. Ich brenne nur weg", sagt er. Es dauert Jahrzehnte, bis Reza gefestigt genug ist, um über seine "Jahre der Taubheit" zu erzählen. Und es dauert weitere Jahre, bis er fähig ist, seine Geschichte aufzuschreiben.
Als wir Schwäne waren wurde von der Kritik ein "Heimatbuch eines Heimatlosen" genannt, ein Roman "über den Verlust von Heimat" und "der Suche danach". Das Ergebnis dieser Suche bleibt offen. Für den Erzähler endet die Ursachenforschung im Sprechzimmer der Therapeutin. Auch sie vermag keine Lösungsmodelle aufzuzeigen, sondern entwickelt lediglich Therapiemöglichkeiten.
Auch Ardas Lebensweg im Vatermal-Roman führt unmittelbar in den prallen, ungeschönten Alltag. Obwohl in Deutschland aufgewachsen und der türkischen Sprache nur noch bruchstückhaft mächtig ("Sag deiner Mutter, sie soll dir endlich Türkisch beibringen!"), spürt er am deutlichsten den Makel, Kind "beschissener Gastarbeiter" (258) zu sein: "In der Schule nennen sie mich Asylanten-Arda ... Sie rufen, dass wir stinken und behaupten, wir wohnen im Müll. Sie fragen, warum wir hässlich sind, obwohl Döner schöner macht. Sie erzählen, wir hätten Läuse und weigern sich, uns zu berühren." (89)
Auch Arda wird Teil einer Jugendgang, nimmt Drogen, dealt, rutscht ab – aber nicht so tief wie seine Freunde, die im kriminellen Milieu stranden. "Wir selbst wurden einander die Väter, die wir nie hatten" (199), resümiert er später. Am Bahnhofsvorplatz, einem beliebten Treffpunkt, lernt er Ausländerfeindlichkeit in brutalster Ausprägung und aus nächster Nähe kennen. Zugleich erlebt er aber mit seinen Freunden auch Momente einer unbeschwerten Jugend. "Schicht um Schicht werden Erinnerungsfragmente einer Ruhrgebietsjugend um die Jahrtausendwende" zusammengetragen, wie es in einer Kritik heißt.
Arda will die Chancen, die sich ihm bieten, nutzen. Er ist ein guter Schüler, schafft das Abitur, fasst schon früh einen ungewöhnlichen Berufswunsch, für den ihn seine Kumpels verspotten, er will "was mit Literatur machen". An seinem Plan hält er unbeirrt fest. Gegen Ende des Romans sitzt er im Hörsaal einer Berliner Universität und lauscht einer Germanistikvorlesung. Seinen Migrationsstatus versucht er möglichst zu kaschieren, was aber nicht nötig ist, weil seine Kommiliton:innen ihn als gleichberechtigt wahrnehmen und akzeptieren.
Doch dann folgt ein radikaler Bruch in seinem Lebenslauf. Arda erkrankt lebensgefährlich an einer Autoimmunkrankheit. Im Krankenbett besinnt er sich auf seine schriftstellerischen Ambitionen: "Ich dokumentiere mein Verschwinden." (16f.) Er schreibt sich alles von der Seele, was er loswerden und bewältigen will. Dabei tritt seine unbewältigte Vaterlosigkeit in den Vordergrund. Wird ihn der Hunderte Kilometer entfernt lebende Metin, der die Familie verraten hat, hören? Wird er Ardas Aufzeichnungen jemals zu Gesicht bekommen? Ein eher sinnloses Unterfangen. Für Arda ist es gleichwohl existenziell. Mit seinem Endlosmonolog setzt der Roman ein.
Vatermal und Als wir Schwäne waren bieten ungeschminkte Einblicke in das Alltags- und Innenleben einer postmigrantischen Jugendgeneration. Diese Aufarbeitung bleibt nicht beim Dokumentarischen stehen, sondern nutzt die der Literatur innenwohnende Möglichkeit der Veranschaulichung. Der Leser/die Leserin wird auf diese Art und Weise ins Geschehen hineingezogen und gewinnt hierdurch einen möglicherweise differenzierteren, weil persönlich gefärbten Blick auf soziale Gegebenheiten und Hintergründe. Eine Stärke der Werke von Öziri und Khani liegt darin, dass sie keine populistischen Klischees aufrufen, sondern für die Darstellung ihrer autobiografisch konnotierten Erinnerungen eine eigene, poetische Sprache gefunden haben. In dieser Hinsicht ergänzen sich ihre Romane zu einer Mentalitätsstudie über das Ruhrgebiet, vergleichbar etwa – was die letzten Jahrzehnte anbetrifft – Ralf Theniors Ja, mach nur einen Plan (1988), den Romanen von Ralf Rothmann (Milch und Kohle, 2000; Junges Licht, 2004), Hilmar Klutes Was dann nachher so schön fliegt (2018) oder Annika Büsings Nordstadt (2022).